Willkommen
Das Johanna-Stahl-Zentrum ist der regionale Ansprechpartner für jüdische Geschichte in Unterfranken. Es dokumentiert die Geschichte der jüdischen Bevölkerung und bietet Veranstaltungen an. Das Zentrum verfügt über eine Fachbibliothek und über Sammlungsbestände. Wichtige Hinweise für Ihre Recherchen sowie Informationen zu einfachen Themen erhalten Sie auf dieser Seite.
Öffnungszeiten während der Wanderausstellung "Geliebte Gabi"
Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 17 Uhr
Freitag von 10 bis 14 Uhr
Der Eintritt ist frei
Bitte beachten Sie: Am 23.04., 24.04., 29.04. und 30.04.2024 bleibt das Johanna-Stahl-Zentrum aufgrund der jüdischen Feiertage geschlossen.


Exkursion nach Dachau
79. Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau
mehr

"Rivalität und Feindschaft von Judentum und Christentum. Absurd?"
Vortrag von Prof. Dr. Michael Wolffsohn
mehr
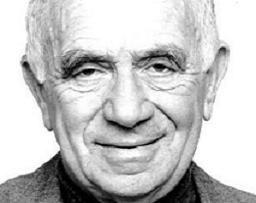
100 Jahre Jehuda Amichai
Literarische Lesung mit Prof. Dr. Amadé Esperer
mehr
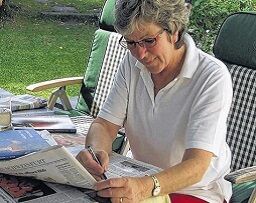
Erfinder und Entdecker - Jüdische Erfolgsgeschichten
Vortrag von Evamaria Bräuer
mehr

Nazis und der Nahe Osten - Buchvorstellung mit Dr. Matthias Küntzel
Wie der islamistische Antisemitismus entstand
mehr

Eröffnung der Wanderausstellung 'Geliebte Gabi'
Ein Mädchen aus dem Allgäu - ermordet in Auschwitz
mehr

Einblicke in die jüdische Bestattungskultur in Franken
Was uns das „Haus der Ewigkeit“ lehren kann – Einblicke in die jüdische Bestattungskultur in Franken
mehr
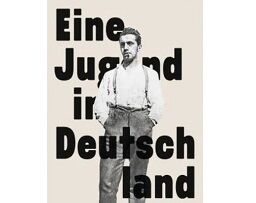
Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland
Buchvorstellung der Neuausgabe der Autobiographie Ernst Tollers mit dem Herausgeber Prof. Dr. Ernst Piper
mehr

„… von seinem alten Kriegsleiden durch einen sanften Tod erlöst“
Drei Schicksale Würzburger Jüdinnen und Juden im Konzentrationslager Theresienstadt
mehr
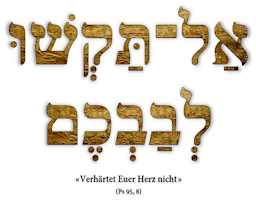
"Verhärtet euer Herz nicht" (Ps 95, 8)
Konzert des Valentin-Becker-Chors mit Einführung in Psalm 95 von Prof. Dr. Theo Seidl
mehr