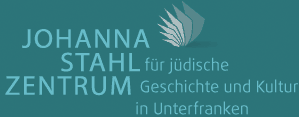Willkommen
DenkOrt 2.0 - Historische Informationsangebote zum DenkOrt
So werden unter „Orte & Menschen“![]() die Orte aufgeführt, aus denen die Menschen stammten. Von dort gelangt man zu den Namen der Deportierten und letztlich auf kurze Biographien der Menschen. Stichjahr für die Zuordnung der Personen zu einem Wohnort ist das Jahr 1933.
die Orte aufgeführt, aus denen die Menschen stammten. Von dort gelangt man zu den Namen der Deportierten und letztlich auf kurze Biographien der Menschen. Stichjahr für die Zuordnung der Personen zu einem Wohnort ist das Jahr 1933.
Die dort angezeigten Daten werden aus der „Biographischen Datenbank jüdisches Unterfranken“ ausgespeist. Artikel zu den jüdischen Gemeinden und Wohnorten können ebenfalls über „Orte & Menschen“, aber auch auf der Seite „Spuren“![]() aufgerufen werden. Dazu unten mehr.
aufgerufen werden. Dazu unten mehr.
Schließlich werden auf der DenkOrt-Website zwei WebApps zur Erinnerungskultur in Würzburg angeboten: Die WebApp „Stationen“![]() zum Deportationsweg präsentiert anschaulich entlang der Strecke des Erinnerungswegs die zentralen Themen des Deportationsablaufs von der Vorgeschichte bis hin zu den Zielen der Transporte. Die WebApp "Kaiserstraße"
zum Deportationsweg präsentiert anschaulich entlang der Strecke des Erinnerungswegs die zentralen Themen des Deportationsablaufs von der Vorgeschichte bis hin zu den Zielen der Transporte. Die WebApp "Kaiserstraße"![]() widmet sich hingegen der Wirtschaftsgeschichte und stellt am Beispiel dieser Würzburger Straße Geschäfte, Firmen, Arztpraxen und Anwaltskanzleien in jüdischem Besitz vor. Alle Geschäftsinhaber*innen werden vorgestellt. Eine Stele an der Straße weist auf diese Firmen hin – und darauf, dass sie bis 1938 alle verschwunden sind.
widmet sich hingegen der Wirtschaftsgeschichte und stellt am Beispiel dieser Würzburger Straße Geschäfte, Firmen, Arztpraxen und Anwaltskanzleien in jüdischem Besitz vor. Alle Geschäftsinhaber*innen werden vorgestellt. Eine Stele an der Straße weist auf diese Firmen hin – und darauf, dass sie bis 1938 alle verschwunden sind.
58 Artikel zu den jüdischen Gemeinden und Wohnorten sind fertig gestellt![]() - zu den Orten, die bereits mit einem Gepäckstück am DenkOrt vertreten sind. Sie zeichnen die Entwicklung der jüdischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung seit dem Jahr 1933 in Kürze nach. Sie zeigen, dass die Gemeinden meist schon seit Jahrhunderten bestanden, und stellen darüber hinaus die unterschiedlichen Schicksale ihrer jüdischen Bewohner und Bewohnerinnen seit 1933 dar. An die Artikel schließt sich eine Liste mit den Namen der Shoa-Opfer an, die 1933 in den jeweiligen Orten gelebt hatten. Hier sind auch die Menschen aufgeführt, die von außerhalb deportiert wurden, sowie jene, die individuell von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden oder aufgrund des steigenden Verfolgungsdrucks Suizid begingen. Nicht berücksichtig sind die Menschen, die vor 1933 den Ort freiwillig verließen.
- zu den Orten, die bereits mit einem Gepäckstück am DenkOrt vertreten sind. Sie zeichnen die Entwicklung der jüdischen Gemeinden und ihrer Bevölkerung seit dem Jahr 1933 in Kürze nach. Sie zeigen, dass die Gemeinden meist schon seit Jahrhunderten bestanden, und stellen darüber hinaus die unterschiedlichen Schicksale ihrer jüdischen Bewohner und Bewohnerinnen seit 1933 dar. An die Artikel schließt sich eine Liste mit den Namen der Shoa-Opfer an, die 1933 in den jeweiligen Orten gelebt hatten. Hier sind auch die Menschen aufgeführt, die von außerhalb deportiert wurden, sowie jene, die individuell von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden oder aufgrund des steigenden Verfolgungsdrucks Suizid begingen. Nicht berücksichtig sind die Menschen, die vor 1933 den Ort freiwillig verließen.
Foto: © JSZ, Foto: Rotraud Ries, 2020